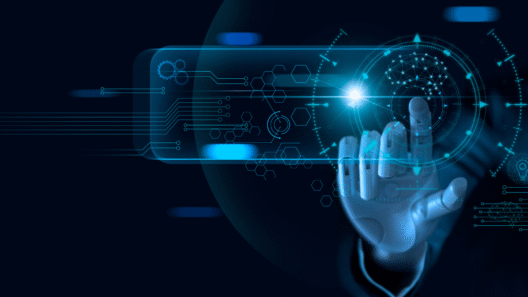Immer mehr Unternehmen setzen auf biometrische Zeiterfassung – etwa durch Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Iris-Scan – um die Arbeitszeit der Mitarbeitenden zu dokumentieren. Diese Technik verspricht Effizienz und schützt vor Manipulation oder verlorenen Ausweisen. Doch sie wirft erhebliche Datenschutzfragen auf.
Biometrische Daten gelten als besonders schützenswert und dürfen nur unter strengen Voraussetzungen verarbeitet werden. Eine Verarbeitung ist laut DSGVO nur mit ausdrücklicher, freiwilliger und informierter Einwilligung erlaubt – ohne Druck oder Zwang.
Nur in Ausnahmefällen – z. B. in Hochsicherheitsbereichen – kann der Einsatz solcher Systeme gerechtfertigt sein. Auch dann müssen Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sorgfältig geprüft werden.
Entscheidend für eine rechtssichere Umsetzung ist, alternative Lösungen wie PINs, Ausweiskarten oder Apps anzubieten. Arbeitgeber sind verpflichtet, biometrische Daten zu verschlüsseln, den Zugriff zu beschränken und klare Löschfristen festzulegen.
Transparenz und Vertrauen sind die Basis für die Akzeptanz solcher Technologien. Unternehmen sollten eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen und Mitarbeitende umfassend informieren.
„Vertrauen entsteht nicht durch Technologie allein, sondern durch Transparenz, Respekt und rechtliche Compliance.“
Innovation darf nicht auf Kosten der Grundrechte gehen. Nur bei verantwortungsvollem Umgang kann biometrische Zeiterfassung sowohl effizient als auch datenschutzkonform funktionieren.